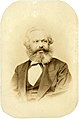Buchdruck-Museum (Hannover)

Das Buchdruck-Museum in Hannover ist ein Museum zur Geschichte der Schwarzen Kunst. Schriftsetzer, Drucker, Buchbinder und andere Fachleute betreiben das „lebendige Museum“, in dem alle Ausstellungsgegenstände auch benutzt werden können und sollen.[1] Standort des Museums ist eine Gebäudegruppe einer ehemaligen Klempner-Werkstatt in einem Hinterhof unter der Adresse Limmerstraße 43 im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord.[2]
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Angebote für Schulen und weitere Aktivitäten[Bearbeiten]

Neben den regelmäßigen Öffnungszeiten für Besucher (einmal die Woche nachmittags) oder vereinbarten Führungen bietet das Buchdruck-Museum insbesondere für Schulen besondere Angebote, beispielsweise zumeist viertägige Projektwochen für Schulklassen bis zum vierten Schuljahr. Hierzu gehören unter anderem die Herstellung und Weiterverarbeitung von Papier.[3]
Darüber hinaus bietet der Trägerverein Freundeskreis Schwarze Kunst e.V. Fachvorträge und Filmvorführungen zur Geschichte des Buchdruckes an.[4]
Das Buchdruck-Museum kooperiert regelmäßig mit dem Museum Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst, dem Historischen Museum am Hohen Ufer und, bei der jährlichen „Nacht der Museen“, mit der Stadtbibliothek Hannover.[5]
Beim jährlichen Limmerstraßenfest öffnet das Museum „für alle“. Außerdem können für auswärtige Veranstaltungen Dritter Druck-Vorstellungen beispielsweise mittels einer mobilen, handbetriebenen Boston-Tiegelpresse vereinbart werden.[5]
Geschichte[Bearbeiten]
Druckereien in Hannover[Bearbeiten]


Hannover entwickelte sich bereits im 19. Jahrhundert zu einem Zentrum zum Teil international tätiger Druckindustrien wie etwa die Geschäftsbücherfabrik J. C. König & Ebhardt. Diese stiftete und begründete etwa das heute im Neuen Rathaus der niedersächsischen Landeshauptstadt aufbewahrte Goldene Buch zum Eintrag der Ehrengäste Hannovers.[6][7]
An die große Zeit der Druckindustrie in Hannover erinnerte unter anderem - als Kunst im öffentlichen Raum - der von Heinrich Ebhardt für den Friedrichswall gestiftete Gutenberg-Brunnen:[8] Die 1890 von Carl Dopmeyer geschaffene Skulptur des Johannes Gutenberg, der als Erfinder des modernen Buchdrucks gilt, wurde später vor der ehemaligen Geschäftsbücherfabrik am Königsworther Platz Ecke Schloßwender Straße aufgestellt.[9][10]
In der ebenfalls international tätigen Druckerei A. Molling & Comp., die von dem jüdischen Unternehmer Max Molling 1897 gegründet worden war, arbeiteten berühmte Künstler wie beispielsweise Kurt Schwitters oder Käthe Steinitz. Doch zur Zeit des Nationalsozialismus wurde die Druckerei 1939 „arisiert“, die Inhaber mussten zwangsweise emigrieren: „Selbst die Nachkommen der Familie wussten [ ... bis Anfang des 3. Jahrtausends] wenig über die Firma“.[11]
Auch das im 19. Jahrhundert gegründete und über Generationen geführte Familienunternehmen Scherrer, das zuletzt als Scherrer - Druck, Daten- und Projektmanagement GmbH auch als Dienstleister den Anschluss an die Zeit der Elektronischen Datenverarbeitung suchte, musste nach einem Einbruch der Nachfrage 2003 schließen.[12]
Nach dem Rückgang der in Hannover ansässigen Druckereien Ende des 20. Jahrhunderts, insbesondere durch den modernen Digitaldruck, und „alarmiert“ durch den drohenden Verlust des damit verbundenen Fachwissens in der gesamten Region Hannover, initiierte der Freundeskreis Schwarze Kunst e.V. im Jahr 2004 das Buchdruck-Museum in Linden. Der Trägerverein setzt sich aktuell aus „mehr als 70 Kollegen/innen aus allen Bereich des Buchdruckes“ zusammen sowie einigen Sponsoren aus der Druckindustrie.[1]
Druck- und Bildtechniken aus und über Hannover[Bearbeiten]
Nach der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg gesellten sich dem Druck von reinen Text-Schriften im Laufe der Jahrhunderte auch zahlreiche bildgebende Verfahren (Illustrationen) hinzu. Diese lassen sich etwa gleichzeitig seit der Zeit der Aufklärung über die Herausbildung eines Bildungsbürgertums insbesondere mit den Erfindungen seit dem Beginn der Industrialisierung feststellen.
Zu den immer preiswerter werdenden Reproduktionstechniken gesellte sich auch die Erfindung der Fotografie: Konnten sich in alten Zeiten nur Könige und die „Oberen Zehntausend“ beispielsweise ein Porträt von sich selbst leisten, machten nach dem ersten in Hannover niedergelassenen Fotografen, Friedrich Wunder, bald Dutzende Mitbewerber das „Lichtbild“ auch für „die kleinen Leute“ erschwinglich.[13]
Mit dem Beginn des 3. Jahrtausends wurden die elektronischen Vervielfältigungsmöglichkeiten von selbsterstellten Texten, Bildern und sogar Filmen durch Computer und Handys sogar für Menschen an der Armutsgrenze beinahe grenzenlos.
1757, Kupferstich aus dem Siebenjährigen Krieg mit einer Karte von Linden und Wettbergen in französischer Sprache des Holländers Jacobus von der Schley
Um 1845, Hand-kolorierter Stahlstich; die Aegidienkirche, nach Georg Osterwald von Johann Poppel
Um 1846, handgemalt: Marie, Königin von Hannover und Kronprinz Ernst August; noch Mitte des 19. Jahrhunderts konnten sich nur die „Oberen Zehntausend“ ein eigenes Bildnis leisten; Ölgemälde von Carl Oesterley in der Henriettenstiftung
1861, Fotografie: Einweihung des Ernst-August-Denkmal vor dem Hauptbahnhof, eine der vier ältesten bekannten Reportagefotografien von Hannover
1867, Porträt-Foto: Karl Marx in Hannover, Fotoabzug aus dem Atelier von Friedrich Wunder
1872, Holzstich „Hannover aus der Vogelschau“; Illustrirte Zeitung nach Carl Grote
1877, Carte de visite vom Kröpcke in Richtung Steintor
1898, Lichtdruck-Verfahren Begrüßung Ihrer Majestät der Kaiserin in Linden durch Jobst Knigge; Ansichtskarte Nr. 552 von Karl F. Wunder
1910, Prägedruck; das erste Goldene Buch Hannovers, entworfen von Heinrich Mittag, im Neuen Rathaus
Um 1920, Steindruck: Der ehemalige Klostergang mit Blick auf den Beginenturm; A. Molling & Comp. nach Ernst Jordan
2013, EDV: Lalesim Ceylan, das Gesicht der „Einbürgerungkampagne der Stadt Hannover“, informiert sich online über die Mahnwache am Klagesmarkt zu den Protesten in der Türkei 2013

Weblinks[Bearbeiten]
- Webseite vom Freundeskreis Schwarze Kunst
- Felix Meschede: "Schwarze Kunst" im Buchdruck-Museum auf der Seite vom Norddeutschen Rundfunk vom 19. März 2013, zuletzt abgerufen am 8. Oktober 2013
- Achim Brandau (inhaltl. Verantwortlicher): Buchdruckmuseum Hannover auf der Seite linden-entdecken.de vom 4. August 2013, zuletzt abgerufen am 8. Oktober 2013
- Buchdruck-Museum Hannover auf youtube.com
Einzelnachweise und Anmerkungen[Bearbeiten]
- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 Jürgen Saalfeldt, Werner Schomburg (Vorsitzende): Über uns auf der Seite des Betreibervereins, zuletzt abgerufen am 8. Oktober 2013
- Hochspringen ↑ Vergleiche die Dokumentation bei Commons (siehe unter dem Abschnitt Weblinks
- Hochspringen ↑ Jürgen Saalfeldt, Werner Schomburg (Vorsitzende): Projekte für Schulkinder, zuletzt abgerufen am 8. Oktober 2013
- Hochspringen ↑ Jürgen Saalfeldt, Werner Schomburg (Vorsitzende): Vorträge, zuletzt abgerufen am 8. Oktober 2013
- ↑ Hochspringen nach: 5,0 5,1 Jürgen Saalfeldt, Werner Schomburg (Vorsitzende): Kooperationen, zuletzt abgerufen am 8. Oktober 2013
- Hochspringen ↑ Waldemar R. Röhrbein: König & Ebhardt, in: Stadtlexikon Hannover, S. 360
- Hochspringen ↑ Klaus Mlynek: Goldenes Buch, in: Stadtlexikon Hannover, S. 225
- Hochspringen ↑ Waldemar R. Röhrbein: EBHARDT, Georg Wilhelm Heinr1ich, in: Hannoversches Biographisches Lexikon, S. 102f. u.ö.; online über Google-Bücher
- Hochspringen ↑ Helmut Knocke, Hugo Thielen: Schlosswender Straße 1-4, in: Hannover Kunst- und Kultur-Lexikon, S. 194
- Hochspringen ↑ Anmerkung: Sowohl das Gebäude der ehemaligen Geschäftsbücherfabrik als auch das Gutenberg-Denkmal stehen heute unter Denkmalschutz; vergleiche Gerd Weiß: Bauten der Bahn, der Industrie und des Militärs, in: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland / Baudenkmale in Niedersachsen / Stadt Hannover, Teil 1, (Bd.) 10.1, hrsg. von Hans-Herbert Möller, Niedersächsisches Landesverwaltungsamt - Institut für Denkmalpflege, Braunschweig/Wiesbaden: Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbh, 1983, ISBN 3-528-06203-7, S. 104f.; sowie Nordstadt, in: Anlage Verzeichnis der Baudenkmale gem. § 4 (NDSchG) (ausgenommen Baudenkmale der archäologischen Denkmalpflege), Stand: 1. Juli 1985, Stadt Hannover, Niedersächsisches Landesverwaltungsamt - Institut für Denkmalpflege, S. 6f.
- Hochspringen ↑ Edel Sheridan-Quantz: Lust und Scherz für's Kinderherz. Von Hannover in die Welt, PDF-Dokument des Faltblattes zur gleichnamigen Ausstellung im Historischen Museum Hannover vom 18. Januar bis 15. April 2012
- Hochspringen ↑ Waldemar R. Röhrbein: Scherrer - Druck, Daten- und Projektmanagement GmbH, in: Stadtlexikon Hannover, S. 540
- Hochspringen ↑ Vergleiche beispielsweise Ludwig Hoerner: Hannover in frühen Photographien. 1848–1910. Schirmer-Mosel, München 1979, ISBN 3-921375-44-4. (Mit einem Beitrag von Franz Rudolf Zankl)
52.3730149.707684Koordinaten: 52° 22′ 22,9″ N, 9° 42′ 27,7″ O (Karte)